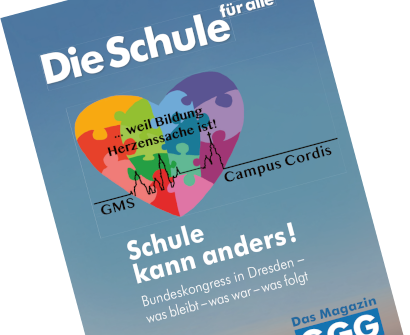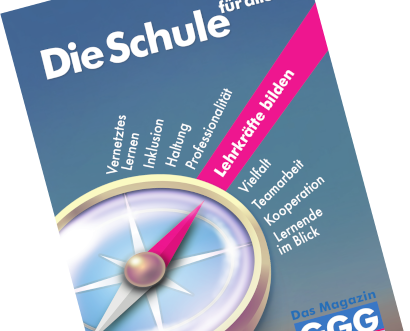GGG-Einschätzung bildungspolitischer Entwicklungen (2010)
Beschluss der Mitgliederversammlung vom 13. November 2010
Die Situation
Nach längerer Abstinenz in Fragen der Schulstruktur, ist in jüngster Zeit (Stand Herbst 2010) erhebliche Bewegung in die bildungspolitische Debatte gekommen. Dabei gestalten sich die Entwicklungen in den Bundesländern uneinheitlich und unübersichtlich. Eine starke Ungleichzeitigkeit sowie Unterschiede bei Einzelregelungen und beim verwendeten Vokabular prägen die Situation. Dennoch sind gemeinsame Tendenzen zu erkennen, u.a.:
- Integrative Schulen (in allen Bundesländern): Heute gibt es Gesamtschulen oder ähnlich arbeitende Schulen – hiermit sind Schulen gemeint, die zu allen Abschlüssen führen und entsprechende Lernangebote machen – in allen Bundesländern; ihre langfristige Existenz ist nicht überall gesichert (z.B. Sachsen). Der Anteil dieser Schulen reicht von Einzelfällen (Bayern(2), Baden-Württemberg(3), Sachsen(9), Sachsen-Anhalt(4), Thüringen (bisher 7)) künftig bis zu über 50 % der Sekundarstufenschulen (Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Saarland) und deutlich mehr (Bremen).
- Einerseits wenig Bewegung (in 6 Bundesländern): In einigen Bundesländern stagniert der Anteil integrativ arbeitender Schulen (Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt). Allerdings haben sich insbesondere in Baden-Württemberg und Bayern Initiativen Gehör verschafft, die längeres gemeinsames Lernen einfordern.
- Andererseits Neugründungen integrativer Schulen (in 10 Bundesländern): In den anderen Bundesländern (Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Thüringen) steigt – in unterschiedlichem politischen Kontext – der Anteil integrativ arbeitender Schulen
◦ durch lokale Initiativen: In zwei Bundesländern (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen) gab und gibt es eine Welle örtlicher Initiativen zur Gründung von Gesamtschulen, bei denen zum Teil erhebliche Interessenunterschiede zwischen Region und (bisheriger) Landespolitik manifest werden. Trotz massiver Behinderungen durch die bisherigen Landesregierungen waren und sind viele dieserInitiativen erfolgreich.
◦ durch Regierungshandeln: In anderen Bundesländern (Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Thüringen, seit kurzem Nordrhein-Westfalen) erfolgt die schulstrukturelle Umgestaltung als Teil der Regierungspolitik.
- Keine Haupt- und Realschulen mehr (in 11 Bundesländern): In sieben Bundesländern (Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) gab es bisher schon keine klassischen Haupt- und Realschulen (mehr). Nun kommen weitere vier Bundesländer hinzu (Berlin, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein), in denen diese Schulen in additiven oder integrierten Systemen aufgehen.
- Alle Abschlüsse in allen Sek I-Schulen (in 4 Bundesländern): In vier Bundesländern (Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland) umfassen alle diese Schulen auch den Weg zum Abitur als Grundbestandteil ihrer Konzeption.
◦ Damit führen dort alle Schulen der Sekundarstufe zum Abitur. Das Monopol der Gymnasien auf das Abitur ist damit endgültig aufgehoben.
◦ Meist dürfen die Gymnasien – zumindest ab Jahrgang 8 – dann auch keine Schüler mehr abschulen, die Gymnasien werden also auch Haupt- und Realschulabschlüsse zu vergeben haben. Hier werden künftig alle Schulen der Sekundarstufe alle Abschlüsse vergeben, in den meisten Bundesländern bisher ein Merkmal nur der Gesamtschulen.
◦ In diesen Bundesländern wird es nach Abschluss der Umwandlung in der Sekundarstufe I mehr integrative Schulen als Gymnasien geben, der größere Teil der Schüler besucht dann integrative Schulen.
Das führt zu der Frage, welche spezifische Aufgabe eigentlich das Gymnasium erfüllt neben der Schule, die grundsätzlich alle Schüler aufnimmt und zu allen Abschlüssen führt.
Darüber hinaus
- ist zwar in keinem Bundesland die Existenz der Grundschule als integrative Schulform gefährdet, aber hier und da wird versucht, in ihr selektive Elemente zu verstärken,
- wird in keinem Bundesland ernsthaft die systematische Einbeziehung des Gymnasiums in die integrative Schule verfolgt,
- wurde in keinem Bundesland bisher die Entwicklung zu einem wirklich inklusiven Schulsystem konsequent eingeleitet.
Wie wir damit umgehen
Die GGG fördert die Idee des gemeinsamen Lernens und unterstützt alle Schulen, die diesem Ziel verpflichtet sind. Die GGG beurteilt konkrete Maßnahmen danach, ob sie Schritte hin zu einer gemeinsamen Schule für alle, Schritte zur Gestaltung eines Schulsystems ohne Aussonderung sind. Das bezieht die Ausgangsposition im jeweiligen Bundesland ein: So könnte dieselbe Entscheidung (z.B. neben dem Gymnasium nur additiv arbeitende Gesamtschulen zuzulassen) in einem Bundesland (z. B. Bayern) ein Fortschritt sein, in einem anderen Bundesland (z.B. Nordrhein-Westfalen) jedoch ein Rückschritt.
Wir achten bei der Beurteilung bildungspolitischer, insbesondere schulstruktureller Maßnahmen darauf, dass sie dazu beitragen,
- die Idee der humanistischen demokratischen Gesellschaft für Ziele und Verfassung der Schule wirksam werden zu lassen.
- internationale Menschen- und Kinderrechte zu respektieren und zu realisieren,
- den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken,
- das Bildungsniveau für alle zu heben und den Anteil der Schulabsolventen ohne Abschluss zu reduzieren und damit die Abhängigkeit des Bildungserfolges von der Herkunft zu reduzieren.
Das heißt für uns im Einzelnen,
- Quantitative Zunahme: dass die Zahl der Schüler/innen zunimmt, die eine integrative Schule besuchen.
- Zeitliche Zunahme: dass der zeitliche Umfang des Besuchs integrativer Schulen zunimmt, bis er die Pflichtschulzeit umfasst.
- Vollständiges Bildungsangebot: dass integrative Schulen ein vollständiges Bildungsangebot erhalten, also einschließlich des Weges zum Abitur.
- Gleichwertige Bildungsangebote: dass das Bildungsangebot, das zum Abitur führt, in integrativen Schulen und Gymnasien tatsächlich gleichwertig ist. Das bedeutet insbesondere
◦ gleiche curriculare Vorgaben, einschl. gleicher Lernstandserhebungen und gleicher Prüfungsanforderungen,
◦ gleiche Zugangsbedingungen zur Oberstufe,
◦ gleiche Berechtigungen, die mit dem Abitur an integrativen Schulen und Gymnasien erworben werden,
◦ die Zulässigkeit des verkürzten Durchlaufs zum Abitur auch in integrativen Schulen (nicht jedoch die Verpflichtung dazu) (am besten durch Regelungen zum individuellen Durchlauf).
- Keine Benachteiligung integrativer Schulen: dass Schulen des gegliederten Systems, die sich zu integrativen Schulen entwickeln wollen, Unterstützung erfahren und nicht benachteiligt werden.
- Keine "Hilfsdienste" für das gegliederte Schulwesen: dass solche Maßnahmen, an denen nur der gegliederte Teil des Schulsystems interessiert ist, nicht zu Lasten der integrativ arbeitenden Schulen gehen oder von integrativ arbeitenden Schulen geleistet werden müssen, z.B.
◦ die Erstellung von Gutachten über den Besuch der Schulart der Sekundarstufe durch die Grundschule,
◦ die Pflicht zur Aufnahme von Schülern, die von Schulen des gegliederten Systems aus Leistungsgründen verwiesen wurden.
- Gleiche Arbeitsbedingungen für Lehrer: dass Lehrer an integrativ arbeitenden Schulen gleiche Arbeitsbedingungn haben, gleichgültig aus welcher Schullaufbahn sie stammen, sowie gegenüber Lehrern an Gymnasien nicht benachteiligt sind, z.B.
◦ beim Gehalt,
◦ bei den Unterrichtsdeputaten,
◦ bei Beförderungen,
- Systemische Verankerung der Pädagogik der Heterogenität: dass die Pädagogik der Heterogenität und der Respektierung der Individualität des Lernens systemisch verankert wird – z.B. durch Ressourcenzuweisung, Rechtsvorschriften und organisatorische Maßnahmen – u.a.
◦ in der Lehrerbildung (Ausbildung der 1. und 2. Phase, Fort- und Weiterbildung) einschließlich der Prüfungen,
◦ in der Lehrerbeurteilung,
◦ bei der Schulentwicklung,
◦ bei der inneren Organisation der Schulen, der Gestaltung des Lernens und der Durchführung schulischer Prüfungen,
◦ bei Schulinspektionen,
◦ bei der Tätigkeit von Beratungs- und Unterstützungsinstitutionen,
◦ bei der Tätigkeit der Schulaufsicht.
- Orientierung der Ressourcenzuweisung an Aufgaben: dass finanzielle, personelle und räumliche Ausstattungen der Schulen abhängig von den übernommenen/übertragenen Aufgaben und ihrem pädagogischen Anspruch sind. In diesem Sinne pädagogisch anspruchsvoll sind für uns Aufgaben wie
◦ die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen (statt mit homogenen),
◦ die Beschulung einer möglichst bevölkerungsrepräsentativen Schülerschaft (statt der Auslese Privilegierter),
◦ die Integration/Inkusion aller (einschl. der Kinder mit Behinderungen) (statt der exklusiven Schule),
◦ die Respektierung der Individualität des Lernens jedes Kindes und Jugendlichen als Grundlage der Lernorganisation (statt eines an Pensen und Gleichschritt orientierten Unterrichts),
◦ die präventive individuelle Förderung (statt des Sitzenlassens),
◦ die Wahrnehmung der Verantwortung für einmal aufgenommene Schüler (statt des Schulverweises wegen minderer Leistungen),
◦ die Gestaltung eines ganztägigen abwechslungsreichen Lern- und Lebensraumes (statt einer Häufung von verbindlichem Unterricht am Vormittag und unverbindlicher Freizeit am Nachmittag).
Die GGG bietet allen Personen und Institutionen in Schule, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Medien ihre Expertise an und fordert sie auf, sich gemeinsam für ein dem demokratischen Menschenbild verpflichteten Schulsystem ohne Aussonderung einzusetzen. Die GGG ist eine Verbündete all jener, mit denen sie sich in dieser Zielsetzung einig weiß.


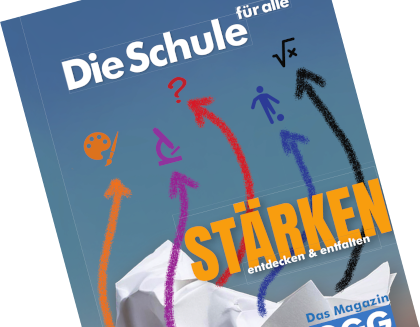
 Die Umwelthilfe, einer unserer Kooperationspartner, hat sich an alle Bundesländer gewandt. Die GGG hat sich dem offenen Brief an die Umwelt-, Kultus- und Bauministerien angeschlossen.
Die Umwelthilfe, einer unserer Kooperationspartner, hat sich an alle Bundesländer gewandt. Die GGG hat sich dem offenen Brief an die Umwelt-, Kultus- und Bauministerien angeschlossen.